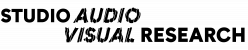Wie kann das Selbst im Film dargestellt werden? Biene Pilavcı hat uns mit ihrem autobiographischen Dokumentarfilm gezeigt, wie es gehen kann.
Der Film beginnt mit Musik, es folgt eine ältere Aufnahme von tanzenden Menschen auf einer Hochzeit – schon in der Anfangsszene scheint der Titel des Films eingelöst zu werden. Dann die Stimme aus dem Off – Biene Pilavcı, die zu ihren Zuschauer*innen spricht, es ist ihr Film, ihre Geschichte. Es wird klar, der Film handelt nicht vom Tanzen (allein).
Man wird direkt ins Geschehen hineingeworfen, weiß sofort, es geht um die Familie, um ihre Familie. Der gesamte Film ist eine Abfolge von alten und neuen Aufnahmen sowie vorgelesenen Tagebucheinträgen aus der Kindheit und Jugend. Der Film entpuppt sich als ein Familienportrait, nicht beschönigend – wie ein Drama, bei dem man einen Platz in der ersten Reihe bekommen hat.
„Tagebucheinträge und alte VHS Aufnahmen, einst stumme Zeugen der Gewalt, ergreifen heute das Wort und tragen zu einem Familienkaleidoskop bei, in der der Wunsch nach einer ganz normalen Familie schmerzhaft deutlich wird, als wir zu einem gemeinsamen Urlaub aufbrechen“, so Biene Pilavcı, in der Filmbeschreibung. Der gemeinsame Urlaub ist die Reise nach Griechenland, zur Hochzeit eines befreundeten Paars. Die Schwestern, der Bruder und die Mutter zusammen an einem Ort. Der Vater ist schon lange nicht mehr Teil der Familie und wohnt heute, nach einer Haftstrafe wegen Vergewaltigung, mit seiner neuen Familie in der Türkei. Diese Reise, der Urlaub, spannt sich wie ein vages Handlungsnetz über den gesamten Film.
Biene Pilavcı ist vor der Kamera zu sehen, lässt sich aber auch hinter der Kamera erahnen, eine Darstellung des Selbst, die wenig inszeniert wirkt. Dadurch wird die Kamera auf zwei Ebenen der Spiegel des Selbst. Sie offenbart den Zuschauer*innen ihren Blick auf das Familiengefüge und gleichzeitig blickt man auf die Filmemacherin, wie sie mitwirkt und trotzdem außen vor ist in ihrer Rolle der provozierenden und konfrontierenden Person. Man schaut hin und erkennt in dem Film die Sehnsucht nach Aufarbeitung, nach, wie es scheint, überfälligen Gesprächen und „Familien-Zusammenführung“, während man immer wieder mit der harten Wahrheit der Vergangenheit konfrontiert wird und begreift, dass diese Familiengeschichte kein Märchen ist.
Als Kind von den Eltern geschlagen verließ Biene Pilavcı mit gerade einmal 12 Jahren die Familie um erst fünf Jahre später zurückzukommen. Ihre Geschwister fühlten sich verlassen, sie selbst weiß, es war notwendiger Selbstschutz. Aus dieser Zeit, bevor sie ging, stammen auch die ersten Aufnahmen. Es zeigt sich, das Filmen war sehr früh eine Leidenschaft – oder doch eher die Möglichkeit, hinzusehen und das „Sein“ in der Familie zu dokumentieren?
Es sind Einblicke in den Alltag der einzelnen Familienmitglieder, die den gesamten Film durchziehen. Immer wieder steht das familiäre Selbst dem regieführenden Selbst gegenüber. Ist es Repräsentation von Realität – von Alltag? – , der durch die Linse zu sehen ist, oder ist es nur eine durch die Kamera beeinflusste Szene? Die Grenzen verschwimmen, denn Biene Pilavcı will ihr Umfeld laut und ehrlich sehen aber gleichzeitig ständig provozieren.
Die Kamera ist Schutzschild und Mittel zur Darstellung zugleich. Biene Pilavcı, spielt mit der Macht der Kamera, verwendet sie, schöpft Erkenntnisse daraus und wird sich der bitteren Wahrheit bewusst: „Am Ende schaffst du es doch nicht aus deiner Haut“. Der/Die Zuschauer*in wird Teil davon, fiebert mit und hat immer das autobiographische Selbst vor Augen, geprägt von Selbstzweifel und großer Stärke.
Am Ende sitze ich vor dem Bildschirm, muss mich erst von dem Bann befreien und durchatmen. Der Film endet, wie er begonnen hat, mit tanzenden Menschen auf einer Hochzeit. Zu sehen, ein letztes Mal, Biene Pilavcı, ihre Geschwister und die Mutter, feiernd und zusammen tanzend – sie alle wirken glücklich – es ist nur eine Momentaufnahme, kein Spiegelbild der Alltagsrealität.